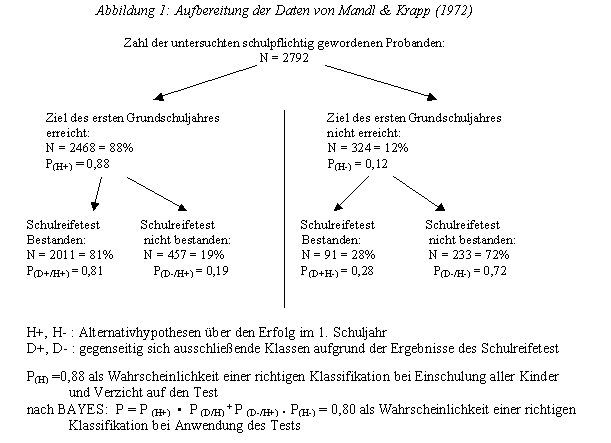
Reimer Kornmann
Den nachfolgenden Text im Adobe Acrobat Format downloaden
Schritte zu einer individualisierenden Lern- und Entwicklungsdiagnostik vom Ausgangspunkt Gießen
(Beitrag zum Psychologischen Symposion anläßlich der Gründung des Psychologischen Instituts der Justus-Liebig-Universität vor 25 Jahren am 6. Juni 1988 in Schloß Rauischholzhausen)
Mein Beitrag fällt wohl ein wenig aus dem Rahmen dieses wissenschaftlichen Programms. Ich werde nämlich nicht so sehr ein bestimmtes Thema aus meiner Arbeit darstellen, sondern ich möchte rekonstruieren, wie ich zu einem bestimmten Forschungsgegenstand gekommen bin. Dabei habe ich mir einen meiner Arbeitsschwerpunkte ausgewählt, bei dem es nicht nur möglich, sondern geradezu notwendig ist, die Einflüsse aus der Gründungsphase des Gießener Instituts auf meine eigene Lerngeschichte aufzuzeigen. Wegen des festlichen Anlasses habe ich jedoch die Gießener Einflüsse besonders hervorgehoben.
Sicher sind meine Ausführungen kein Baustein, vielleicht auch nicht einmal ein Mosaikstein zur Rekonstruktion der Geschichte dieses Instituts – aber ich denke doch, dass sie ein wenig Kitt dazu liefern werden, wenn einmal diese Aufgabe in Angriff genommen werden sollte.
Im Wintersemester 1962/63, als das Psychologische Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen seine Arbeit wieder aufnahm, begann ich mein drittes von insgesamt vier Studiensemestern am Freiburger Institut für Psychologie, damals noch unter der Leitung von Robert Heiß.
Der Grund für die Wahl dieses Studienortes lag wohl in erster Linie darin, dass ich zuvor, seit 1959, – neben meinem Pädagogik-Studium – auch für Psychologie an der Universität Hamburg eingeschrieben war. Dort hatte ich im Sommer 1960 den Wechsel der Institutsleitung von Curt Bondy zu Peter Rudolf Hofstätter erlebt, besser: erlitten. Erlitten insofern, als nun plötzlich die Inhalte und Formen des Psychologie-Studiums ganz und gar nicht mehr meinen Vorstellungen entsprachen, ebenso wie meine Studienleistungen – vor allem in den methodischen Fächern – ganz und gar nicht in Einklang mit den Anforderungen von Hofstätter und seinen Mitarbeitern zu bringen waren. Solche wechselseitigen Diskrepanzen blieben damals – bei insgesamt etwa 150 Psychologie-Studenten über alle Semester hinweg – niemandem verborgen, und so vollzog ich die drohende Exkommunizierung dann selbst, indem ich einfach nach Freiburg wechselte. Aus Hamburger Sicht galt ich nun für die Psychologie als verloren: Nicht Guilford, Eysenck und Cattell wie in Hamburg, sondern Klages, Lersch und Heiß waren in Freiburg die persönlichkeitstheoretischen Leitfiguren. Freilich: In Freiburg wurden auch Leistungsnachweise in Statistik I und Statistik II verlangt; diese Kurse leitete damals Herr Michel – übrigens mit großem Verständnis und viel Geduld gegenüber denjenigen, die kognitiv und emotional begründete Probleme mit der Materie hatten.
Diesen Anforderungen konnte ich durchaus rite entsprechen, doch ein großer Teil des übrigen Lehrangebots, vor allem die Diagnostik-Kurse – vorgesehen und von mir in Klausuren erworben waren 2 Scheine in Farbpyramiden-Test, 3 Scheine in Rorschach-Diagnostik und gar 4 Scheine in Graphologie! – überzeugten mich nicht von der Wissenschaftlichkeit der fachlichen Ausrichtung. Zum Glück war ich ja nicht ganz unbefangen nach Freiburg gekommen. Eine gewisse Orientierungslosigkeit hätte die Folge meines Wechsels sein können: Die empirisch ausgerichtete Psychologie Hamburger Provenienz, welche die individuellen Charakteristiken vernachlässigt, konnte und sollte es nicht sein, aber ebensowenig befriedigte mich eine ganz und gar individuumbezogene Psychologie Freiburger Denkungsart, welche sich jeglicher ordentlicher Empirie enthielt. Diese drohende Orientierungslosigkeit muß es wohl gewesen sein, die mich in die – ja keineswegs rhetorisch brillianten oder didaktisch besonders sorgfältig strukturierten – Kollegs von Wewetzer trieb, der damals eine außerordentliche Professur in Freiburg innehatte. Sein klinisches, auf die Entwicklung des konkreten Individuums ausgerichtetes Interesse, verbunden mit der Forderung nach einer konsequent problemangemessenen, streng empirisch ausgerichteten Methodik in Theorie und Praxis, schien mir einen Weg zu weisen, auf dem ich gehen konnte und gehen wollte.
Nach Wewetzers Berufung an das wieder eröffnete Gießener Institut war Freiburg für mich nur noch für die Vordiplom-Prüfung interessant. Nachdem ich hierfür alle erforderlichen formalen Voraussetzungen erworben hatte, verabschiedete ich mich von Freiburg, um in Hamburg die restlichen Voraussetzungen zur Meldung für meine 1. Lehrerprüfung zu erfüllen.
In diesen zwei Hamburger Semestern belegte ich auch einzelne Vorlesungen und Seminare in Psychologie, vor allem bei Hofstätter, Lienert und Eyferth. Hier lernte ich dann meinen späteren Weggenossen und Freund Ludwig Leute kennen, der auf eine ganz ähnliche Lerngeschichte wie ich zurückblicken konnte und die Psychologien, wie sie damals in Hamburg und in Freiburg betrieben wurden, ebenso einschätzte wie ich. Meinen Vorschlag, das Heil in Gießen zu suchen, wollte er kritisch prüfen. Folglich bereiste er neben Gießen auch Marburg und Tübingen, um sich vor Ort bei den Institutsdirektoren und Mitarbeitern nach den Studienbedingungen zu erkundigen. Das war damals nichts Außergewöhnliches: Der Student suchte sich seinen Studienort aus, indem er die zuständigen Fachvertreter einfach fragte, was sie ihm denn fachlich so zu bieten hätten. Ludwig Leutes Tripel-Vergleich mit den Anker-Reizen Freiburg und Hamburg fiel nun bekanntlich zugunsten von Gießen aus: Tübingen schien ihm von der Ausrichtung her Freiburg noch zu ähnlich zu sein, und Marburg konnte ihm fachlich gegenüber Hamburg keine echte Alternative bieten; darüberhinaus hätte Marburg gegenüber Gießen den großen Nachteil – so ein ganz starkes Argument eines der von Leute konsultierten Gießener Assistenten –, dass es dort, also in Marburg, nicht einmal eine Bar gäbe, während hier in Gießen diesbezüglich keinerlei Mangel herrsche.
Der Entschluss, zum Wintersemester 1964/65 nach Gießen zu gehen, stand also für uns beide fest. Als ich das Gebäude in der Dietz-Straße zur Aufnahme meiner Studien erstmals betrat, liefen mir drei schwarzgewandete Figuren über den Weg: die Herren Amitai, Uwe Hentschel und Claus Stoll, die ersten, die – als sogenannte Quereinsteiger ebenso wie wir von anderen Universitäten gekommen – gerade ihre Diplom-Prüfung ablegten. Die nächsten Aspiranten für das Diplom waren nun Ludwig Leute und ich, während die ersten Gießener Eigengewächse – die Herren Flakowski (†), Boucsein, Greif, Hamster, Hehl und Possehl – gerade ihr drittes und viertes Studiensemester begannen. In höheren Semestern, aber erst kurz vor oder nach dem Vordiplom stehend, studierten damals noch die Herren Kuballa, Leichner, Schmitt und Tolkmitt. Einzelne Studentinnen gab es auch, aber die waren alle in tieferen Semestern und daher dankbar für die großzügig gewährten fachlichen Hilfen ihrer älteren Kommilitonen.
Insgesamt waren wir damals gerade 18 Studentinnen und Studenten im Hauptfach – nicht einmal doppelt so viele wie Angehörige des Lehrkörpers, nämlich Wewetzer, Jäger, Spitznagel, der für Herrn Michel gekommen war, Janke, Kristof, Fürntratt, Frau Balzert, Todt, Dietsch, König und Stoll.
Fräulein Beckmann als Sekretärin und – damals schon – Herr Reuschling als Techniker
hatten trotzdem gut zu tun; richtig schuften hingegen musste Herr Jantzen, der
– als Studentische Hilfskraft – die täglich meterweise eintreffenden Bände für
die neu aufzubauende Bibliothek mit Signum versehen und die Karteikarten für
die Kataloge schreiben musste.
Link zum Dokument: Frühe Erinnerungen an Wolfgang Jantzen
Diese Anfangsphase, gekennzeichnet vor allem durch einen personell gut ausgebauten Lehrkörper und nur wenige Studenten, hielt in Gießen vergleichsweise lang an und dürfte wohl in erster Linie den recht herben Reizen der Stadt und weniger einem irgendwie gearteten Ruf des Psychologischen Instituts zu verdanken sein: Andere Institute oder Seminare, z.B. die Romanisten, gegen die wir gelegentlich Fußball spielten, hatten nämlich ebenfalls Aufstellungsschwierigkeiten.
In dieser Situation war es einfach, die Studenten umfassend am Institutsleben teilhaben zu lassen. Diese Möglichkeit wurde uns Studenten auch geboten, und einige von uns machten gerne Gebrauch davon. So konnten Lehrende und Studierende nicht nur in den wirklich privatissime anmutenden Lehrveranstaltungen sich sehr intensiv austauschen, sondern auch im Rahmen von Forschungsprojekten und den vielen mehr oder weniger informellen Anlässen bestand hierzu ausreichend Gelegenheit.
Einen wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkt für Lehre und Forschung bildeten damals Fragen der psychologischen Diagnostik. Der entsprechende Rand 6 des Handbuchs der Psychologie war 1964 gerade erschienen, und Mitglieder des Gießener Instituts stellten – natürlich in geziemendem Abstand zu den Freiburgern – den zweithöchsten Anteil der Autoren. [1]
Wewetzers überzeugende Forderung nach differentieller Validität diagnostischer Verfahren ließ sich für mich gut in Verbindung bringen zu zwei Arbeiten von Janke: Seine „Experimentellen Untersuchungen zur Abhängigkeit der Wirkung psychotroper Substanzen“ [2] belegten die Notwendigkeit differentialpsychologisch indizierter, in ihrer Wirkung vorhersagbarer Treatments, und sein Handbuch-Artikel über „Klassifikation“ [3] führte mir die Vielfalt der Probleme, aber auch einige Möglichkeiten vor Augen, die zur Verwirklichung von Wewetzers Anliegen zu berücksichtigen waren. Vertieft wurden diese Aspekte in einem Seminar von Jäger über Eignungsdiagnostik, in dem wir uns sehr gründlich mit dem damals noch nicht so gut in Deutschland eingeführten Werk von Cronbach und Gleser über „Psychological Tests and Personnel Decisions“ [4] beschäftigten, und in einem Seminar von Spitznagel wurden einzelfalldiagnostische Fragen mit direktem Praxisbezug thematisiert, wobei wir damals schon auf die Notwendigkeit hingewiesen wurden, bei der Diagnostik die gesamte, vor allem die soziale Situation der Diagnosticanden zu berücksichtigen.
Eine Episode, die zeigt wie intensiv, in welchen Rahmen und bei welchen Anlässen es damals möglich war, fachliche Probleme zu diskutieren, ist mir noch in lebendiger Erinnerung. Sie muß wohl im Jahre 1965 gespielt haben. Am hellichten Tage jedenfalls gab es Sekt im Institut, und der Grund dafür war, dass einer der Mitarbeiter – ich meine, es müsste Herr Kristof gewesen sein –, Vater geworden war, und zwar erneut Vater einer Tochter, seiner zweiten oder dritten. Aus diesem erfreulichen Anlass entspann sich bald eine Diskussion darüber, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Sohnes für den Fall sei, dass sich der Herr ein weiteres Mal bemühen würde: Die Anhänger der bedingten und die der unbedingten Wahrscheinlichkeiten gerieten aneinander und weiteten das Thema schier unendlich aus – sicher waren auch Stoll und Fürntratt dabei. Die Diskussion endete keineswegs am Abend, sie wurde nur unterbrochen, weil es Donnerstag war und man zum Abend-Kolloquium nach Marburg fuhr. Im Anschluss daran ging die Diskussion, ich glaube, es war im „Krug zum grünen Kranze“, ohne Ergebnis weiter bis zum Morgengrauen. Ich selbst hatte dabei jedoch Sympathien für die Bayesianer gewonnen.
Wahrscheinlich habe ich diese Begebenheit deswegen in Erinnerung behalten, weil ja die Berücksichtigung von a priori-Wahrscheinlichkeiten ein wesentliches Element bei der angemessenen Lösung von Klassifikationsproblemen ist. Klassifiktionsprobleme waren nämlich ein wesentlicher Schwerpunkt meiner Arbeiten in den ersten Jahren nach meiner Diplom-Prüfung, die ich zusammen mit Ludwig Leute im Herbst 1965 ablegte. Unmittelbar danach volontierte ich einige Monate in den pharmakopsychologischen Projekten von Herrn Janke, bis ich im April 1966 für ein Jahr eine Stelle als Psychologe an der Universitäts-Kinderklinik in Münster antrat. Danach kehrte ich nach Gießen zurück, wo ich im Rahmen des DFG-Projektes zur „Differenzierung des organischen Psychosyndroms bei kindlicher Hirnschädigung“ ein Thema für meine Dissertation erhielt. Das Projekt wurde von Wewetzer und Stutte, dem damaligen Leiter der Marburger Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, gemeinsam geleitet. Bei meiner Dissertation ging es darum, innerhalb der Gruppe schulpflichtig gewordener, aber wegen fehlender Schulreife nicht eingeschulter Kinder die hirngeschädigten Kinder mittels psychodiagnostischer Methoden zu identifizieren und von denjenigen Kindern eindeutig zu unterscheiden, deren mangelnde Schulreife keine erkennbare hirnorganische Ursache hatte. Diese Zielsetzung ließ sich von folgenden Annahmen leiten:
1. Vor allem gestaltspsychologisch orientierte Autoren behaupten die Existenz hirnschadensspezifischer Leistungsausfälle besonders in bestimmten Bereichen der Wahrnehmung bei ansonsten mehr oder weniger normaler kognitiver Entwicklung
2. Diese Folgen von Hirnschädigungen sind Ursache des Schulversagens, das bei den betroffenen Kindern gehäuft auftritt
3. Dem Schulversagen ist durch spezifische Maßnahmen, die auf die Schädigungsfolgen abgestimmt sein müssen, vorzubeugen
4. Hirngeschädigte Kinder mit solchen Leistungsausfällen müssen daher spätestens bei Schuleintritt identifiziert werden.
Ausgehend von diesen Annahmen konnte ich durch meine Untersuchungen die Forderung Wewetzers erfüllen, „dass gezieltere Verfahren entwickelt werden, deren Gültigkeitsbereich auf einzelne Entwicklungsphasen, auf einzelne Niveaustufen und für spezifische Fragestellungen begrenzt ist ...“ (S. 222). [5]
Meine Dissertation ist unter dem Titel „Hirnschädigung und fehlende Schulreife“ 1971 in erster und 1973 in zweiter Auflage veröffentlicht worden. [6] Die darin beschriebene und er- probte Testbatterie ist später, 1977, nach weiteren Erhebungen zur Standardisierung und zur Bestimmung differentieller und prognostischer Validitäts-Aspekte mit dem Titel „Testbatterie für entwicklungsrückständige Schulanfänger“ erschienen, und sie erfreut mich nach wie vor mit gleichbleibend hoher Nachfrage. [7] Auf dieses Verfahren komme ich später zurück. Das Thema meiner Dissertation brachte es nun mit sich, dass ich mich auch mit Fragen der Diagnostik im Rahmen der Behindertenpädagogik beschäftigte, und so ergab es sich, dass ich im Anschluss an eines der schon erwähnten Marburger Kolloquien gefragt wurde, ob ich ei- nen Lehrauftrag am Institut für Heil- und Sonderschulpädagogik der Universität Marburg übernehmen wolle, Thema: „Psychodiagnostik des Sonderschulkindes“.Ohne zu durchschauen, was damit an Brisanz und Problematik auf mich zukommen würde, sagte ich zu. Bald erkannte ich jedoch, auf was ich mich da eingelassen hatte:
Angehende Sonderschullehrer – als Aufbaustudenten fast alle älter als ich – sollten für eine spezielle selektionsdiagnostische Aufgabe, die Feststellung der Sonderschulbedürftigkeit einzelner Kinder, zugerüstet werden – und dies
1. vor dem Hintergrund absolut unzureichenden entscheidungstheoretischen und politischen Wissens
2. mit einem absolut unzulänglichen Methoden-Inventar
3. innerhalb eines für die Beantwortung der Frage absolut ungeeigneten organisatorischen Rahmens.
Mit einigen Kollegen des Gießener Instituts führte ich ernste Diskussionen, ob die Wahrnehmung einer solchen Aufgabe überhaupt zu verantworten sei. Damals setzte ich – wie ich es auch heute noch tue – auf die Zukunft und die damit erhoffte Zunahme an Vernunft bei Bildungspolitikern und Schulaufsichtsbeamten. Mein Ziel war es, langfristig daraufhin zu arbeiten, dass
1. die Entscheidung der Sonderschulbedürftigkeit im team, unter starkem Einbezug diagnostisch kompetenter Psychologen, getroffen werden sollte
2. ein klassifikationsdiagnostisch optimales Methoden-Inventar erarbeitet wird
3. die Schulwirklichkeit so verändert wird, dass selektionsdiagnostische Fragestellungen eine vernünftige, solide Grundlage haben.
Das war natürlich sehr, sehr blauäuigig! Gleichwohl dachte und arbeitete ich zunächst in dieser Richtung weiter, als ich 1969 nach Abschluss der Untersuchungen zu meiner Dissertation eine Stelle als Wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Heilpädagogische Psychologie der Pädagogischen Hochschule Ruhr in Dortmund antrat und dann zwei Jahre später auf die neu eingerichtete Professur für Psychodiagnostik bei Lernbehinderten“ an die Pädagogische Hochschule Heidelberg berufen wurde, wo ich seither verblieben bin.
In der deutschen Sonderpädagogik wie auch in der deutschen Pädagogik überhaupt gab es damals nicht die geringste Sensibilität für das Problem des Zusammenhangs zwischen Testgüte, Selektionsquote und Fehlklassifikationen bei Selektionsentscheidungen, ganz abgesehen von der Beachtung der Kosten-Nutzen-Relation. Trotzdem oder gerade dennoch wurde fleißig getestet und ausgelesen, und die Nachfrage nach psychometrischen Tests wurde in vielen Publikationen gefördert und auch befriedigt – etwa durch die Reihe der Deutschen Schultests.
In dieser Situation ist mir ein kleiner Coup gelungen. Aufgrund meiner Dissertation und der weiterführenden Arbeiten verfolgte ich die Literatur zur Einschulungsdiagnostik sehr genau und stieß auf Arbeiten von Krapp und Mandl [8] über eine große Augsburger Längs-chnittuntersuchung: 2792 schulpflichtig gewordene Kinder wurden mit einem Schulreifetest untersucht und ausnahmslos eingeschult – auch solche, die aufgrund des Testergebnisses eigentlich hätten zurückgestellt werden sollen. Nach einem Jahr wurde der Schulerfolg aller Kinder aufgrund mehrerer kombinierter Kriterien ermittelt und mit + oder – in jedem einzelnen Fall bewertet. Krapp und Mandl werteten dieses schöne Material lediglich unter der Fragestellung aus, wie hoch die prognostische Validität des verwendeten Schulreifetests sei, und welche Probleme mit der Verwendung fixer cut off-scores verbunden sind. Bei einer anderen Aufbereitung des Materials konnte ich nun zeigen, dass die Auswertung des Schulreifetests eine größere Zahl von Fehlklassifikationen nach sich zieht als der Verzicht desselben bei gleichzeitiger Einschulung aller Kinder (vgl. Abbildung 1).
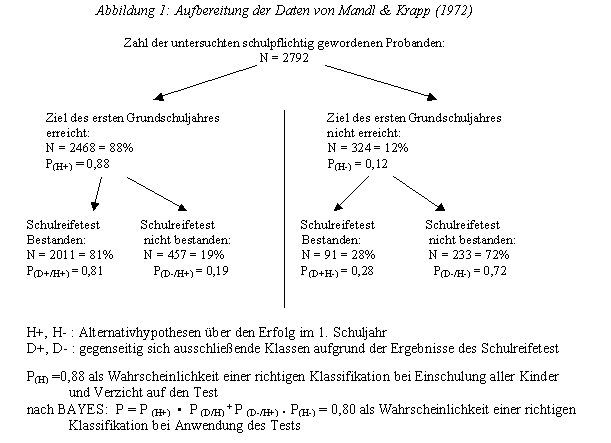
Das Ergebnis dieser Studie, die 1972 in der Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie veröffentlicht wurde, [9] konnte Tiedemann (1974) generell für alle weiteren Schulreifetests bestätigen. [10] In der Fachliteratur wurde der Befund durchaus zur Kenntnis genommen und – soweit mir bekannt – nur positiv gewürdigt. Doch weder bei Testautoren noch bei Bildungspolitikern und Schulaufsichtsbeamten führte dies zu irgendwelchen Konsequenzen. Das gab mir zu denken. Langsam begann ich mir, meiner Blauäugigkeit bewußt zu werden. Verstärkt wurde dieser Prozess der Selbsterkenntnis durch einen Befund meines Marburger Kollegen Holger Probst. Er führte eine sorgfältig angelegte empirische Studie an solchen Schülern durch, die im Rahmen des Sonderschulaufnahmeverfahrens testdiagnostisch untersucht und entweder als sonderschulbedürftig oder als nicht sonderschulbedürftig klassifiziert worden waren. Diese Klassifikation versuchte Probst zum einen mittels eines Intelligenztests, dem HAWIK, und zum anderen mittels einiger schnell einzuholender, objektiv überprüfbarer Informationen zur wirtschaftlichen Situation der Familie zu replizieren. Es zeigte sich, dass die Zahl der Fehlklassifikationen mittels der Fragen zur Beschreibung der ökonomischen Lage keineswegs höher war als aufgrund der vergleichsweise aufwendigen testdiagnostischen Strategie. [11] Auch dieser Befund bewirkte keinerlei Veränderungen bezüglich der Vorschriften zur Durchführung des Sonderschulaufnahmeverfahrens. Auch verschiedene Arbeiten meines früheren Heidelberger Kollegen Hans-Peter Langfeldt, in denen die schulorganisatorischen Voraussetzungen des Umschulungsverfahrens als widersinnig dargestellt wurden, blieben praktisch folgenlos. Langfeldt argumentierte, dass sich die Richtigkeit einer Umschulungsentscheidung praktisch nie widerlegen lasse, wohingegen eine Nicht-Aufnahme in die Sonderschule sich durchaus als falsch erweisen könne. Folglich gebe es gar keine vernünftige Alternative zu der Strategie, jedes Kind, das zur Überprüfung auf Sonderschulbedürftigkeit angemeldet wird, auch in die Sonderschule aufzunehmen. Für eine solche Strategie benötige man aber keine diagnostische Untersuchung, geschweige denn Tests. [12]
Diese und weitere Erkenntnisse, die ich in der ersten Hälfte der 70er Jahre auch und vor allem auf der Grundlage meiner Gießener Studienzeit gewinnen konnte und nicht zuletzt auch die Nachwirkungen von Impulsen aus der Studentenbewegung veranlassten mich, die klassifikationsdiagnostischen Schwerpunkte meiner Arbeit aufzugeben und andere diagnostische Aufgabenfelder für meine Zielgruppe, nämlich Lehrer, die behinderte und im Lernen beeinträchtigte Kinder unterrichten, zu erschließen. Das war die Zeit, als in der Klinischen Psychologie diagnostische Aufgaben und Vorgehensweisen im Rahmen von Modifikationsstrategien formuliert und denen von Selektionsstrategien gegenübergestellt wurden, als die Orientierung der Diagnostik am Individualtheoretischen Paradigma und Medizinischen Modell kritisiert und eine Ausweitung des Gegenstandes und der Fragestellungen über den individuellen Bezugsrahmen hinaus gefordert wurde, als schließlich auch begonnen wurde, die Frage des jeweiligen Menschenbildes, das mit den verschiedenen psychologischen und psychodiagnostischen Ansätzen verbunden ist, zu thematisieren.
Im Bereich der Behindertenpädagogik, der ich mich mittlerweile doch stärker als der Psychologie verbunden fühlte, wurden diese Fragen ebenfalls diskutiert – und ich denke, wesentlich heftiger und programmatischer als damals im Bereich der Psychologie. Auch ich beteiligte mich mit konzeptionellen, programmatischen und kasuistischen Arbeiten, die mit dem Stich-, Schlag- oder Reizwort „Förderungsdiagnostik“ oder „förderungsorientierte Diagnostik“ assoziiert werden, an dieser Debatte. [13] Die dafür investierte Zeit fehlte natürlich für empirische Untersuchungen. Dennoch konnte ich über all die Jahre hinweg einen Ansatz weiterverfolgen, zu dem ich erstmals durch verschiedene Gedanken von Wewetzer angeregt worden bin. Ausgangspunkt war wiederum das Problem der differentiellen Validität – festgemacht jedoch an Lösungen bzw. Nicht-Lösungen einzelner Items. Versuchspersonen, die das gleiche Item lösen – so der mir durch Wewetzer nahegebrachte Gedanke -, verfügen alle zumindest über die Kompetenzen, die zur Bewältigung des entsprechenden Items erforderlich sind. Insofern sind sie miteinander vergleichbar und in diesem Sinne ist für sie das entsprechende Item nicht relativ aussagekräftig. Für Versuchspersonen, die das entsprechende Item nicht lösen, gilt jedoch die analoge Intgerpretation, sie würden über die zur Lösung notwendigen Kompetenzen nicht verfügen, keineswegs. Hinsichtlich der Bedingungen, die zur Nicht-Lösung geführt haben, müssen diese Versuchspersonen also keineswegs miteinander vergleich bar sein.
Nun kann vorausgesetzt werden, dass es Tests gibt, die inhaltlich valide sind, die also mehr oder weniger gut solche Anforderungen repräsentieren, mit denen die Versuchspersonen auch in realen Situationen, z.B. beim Lernen, Probleme haben. Für diese Versuchspersonen sollen – das ist eine weitere Voraussetzung – erfolgversprechende Ansätze zu einer Förderung ermittelt werden. Für diese Zielsetzung ist nun die Feststellung, dass bestimmte Items oder eine bestimmte Menge von Items nicht gelöst worden sind, zwar wichtig, aber nicht besonders ergiebig. Es fehlen Informationen darüber, an welchen Bedingungen die Lösung scheiterte. Die Kenntnis dieser Bedingungen – so eine weitere Annahme – ist für eine effektive Förderung unabdingbar. Ganz im Sinne der Forderungen von Wewetzer [14] machte ich es mir daher zur Aufgabe, für verschiedene Tests bzw. für verschiedene inhaltliche Anforderungen sequentielle diagnostische Strategien zu entwickeln, durch welche die Bedingungen der Nicht-Bewältigung im Einzelfall ermittelt werden können. Auftrieb gaben mir die Ergebnisse einer experimentellen Studie mit lernbehinderten Sonderschülern und leistungsmäßig unauffälligen Grundschülern, welche den Bildertest 1-2 und anschließend zwei Varianten dieses Tests zu bearbeiten hatten. Es ließ sich zeigen, dass die lernbehinderten Sonderschüler, nicht aber die Grundschüler, durch den schriftlichen Lösungsmodus und die Gruppensituation im Original-Test benachteiligt waren, und dass nur sie durch systematisch induzierte Testvarianten verbesserte Leistungen erzielten. Ich hatte übrigens die Chuzpe, mich kurz nach meiner Promotion hier in Gießen auf eine recht hoch dotierte Professur zu bewerben, und bei dieser Gelegenheit trug ich diese Ergebnisse schon einmal – allerdings etwas ausführlicher als heute – vor. 1972 wurden sie in der Diagnostica publiziert. [15]
Für die Zielsetzung herauszufinden, ob und ggf. durch welche Variationen der Testbedingungen bei ansonsten inhaltlich identischen Anforderungen sich Leistungsverbesserungen erzielen lassen, konnte ich natürlich auch das aus der Rorschach-Diagnostik bekannte Prinzip des „testing the limits“ sowie auf Anregung aus Kurt Gottschaldts Buch „Der Aufbau des Kindlichen Handelns“ zurückgreifen. [16] Hierauf hatte mich schon Wewetzer seinerzeit aufmerksam gemacht.
Das Prinzip der kontrollierten Aufgaben-Variation und der systematischen Erfassung ihrer Effekte im Einzelfall habe ich für die schon erwähnte „Testbatterie für entwicklungsrückständige Schulanfänger“ genutzt. Im Anschluss an die Original-Durchführung werden die jeweils leichtesten Items eines Untertests, die ein Kind nicht gelöst hat, erneut unter veränderten Bedingungen vorgegeben. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen. In der Originaldarbietung des Wortschatztests sollen die Versuchspersonen auf das Bild zeigen, dessen Bezeichnung der Versuchsleiter ihnen zugesagt hatte. Eine Variation sieht nun vor, dass die Versuchsperson, bevor sie zeigt, die vom Versuchsleiter vorgegebene Bezeichnung verbal wiederholt. Für die Kinder, bei denen durch eine solche Variation erhebliche Leistungsverbesserungen resultieren, ist nun ein solches Resultat im Hinblick auf mögliche Erklärungen ihrer Probleme und im Hinblick auf Ansätze zu deren Überwindung von ziemlich großer Bedeutung. Dies mag auch das zweite Beispiel verdeutlichen. Es bezieht sich auf alle Untertests der Testbatterie, bei denen zur erfolreichen Bearbeitung der Items eine dextrade Wahrnehmungs- und Arbeitsrichtung, also eine von links nach rechts, vorgesehen ist – z.B. beim Fortsetzen vorgegebener Reihen oder bei Tracing-Aufgaben. Es ließ sich nun zeigen, dass für manche Versuchspersonen lediglich die Umkehrung der Arbeitsrichtung er erheblichen Leistungsverbesserungen führte. Bei Versuchspersonen im Einschulalter, die besser von rechts nach links als von links nach rechts arbeiten, und die dies deswegen auch gewohnt sind, ist anzunehmen, dass sie mit dem Schriftspracherwerb Schwierigkeiten bekommen, sofern sie sich nicht an die umgekehrten Wahrnehmungs- und Arbeitsrichtung gewöhnen.
Auf weitere, auch die Motivation berücksichtigende Varianten der Testbatterie gehe ich nicht ein.
Etwa seit Mitte der 70er Jahre wurde mir zunehmend deutlich, dass meine bisherigen Arbeiten zwar von einigem technologischen Wert sein mochten, aber – wie das bei Diagnostikern wohl nicht ganz unüblich war und ist – ein beträchtliches Theorie-Defizit aufwiesen. Wer in der deutschen Behindertenpädagogik nach soliden und umfassenden theoretischen Konzepten sucht, wird wohl an Wolfgang Jantzen nicht vorbeikommen – eben jenen Wolfgang Jantzen, der – wie schon erwähnt – in den Gründerjahren des Instituts einen großen Teil der Bücher-Rücken der Instituts-Bestände zu bekleben und zu beschriften hatte, und der kürzlich als erster Gastprofessor aus der Bundesrepublik Deutschland den Wilhelm-Wundt-Lehrstuhl in Leipzig für ein halbes Jahr innehatte. Vor allem durch seine Arbeiten [17] sind mir die Bedeutung und der theoretische Wert der Forschungen, welche die Kulturhistorische Schule sowjetischer Psychologen hervorgebracht hat, bewusst geworden. Ihre Erkenntnisse lassen sich durchaus auch mit vielen Forschungsergebnissen westlicher Provenienz in Einklang bringen, die seit der berühmten kognitiven Wende hervorgebracht wurden.
Durch die Beschäftigung mit Jantzen und Vertretern der Kulturhistorischen Schule gewann ich theoretisch begründbare Hinweise für die Variation von Testbedingungen und – in einem weiteren Rahmen – von Leistungsanforderungen überhaupt. Solche Grundlagen bieten zum einen die Aneignungstheorie, die hier vor allem mit den Namen von A.N. Leontjew und Galperin in Zusammenhang gebracht wird und teilweise sehr große Übereinstimmung mit Aussagen von Piaget und Bruner aufweist, und zum anderen die Handlungsregulationstheorie, wie sie etwa Hacker und Volpert formuliert haben. [18] [19] Diese baut unter anderem auf den Erkenntnissen der Aneignungstheorie auf. Übrigens greift auch ein ehemaliger Gießener Weggenosse, Siegfried Greif, bei seinen organisationspsychologischen Arbeiten auf sie zurück. [20]
Soweit diese theoretischen Grundlagen für meinen Arbeitszusammenhang wichtig waren, habe ich sie in meinen entsprechenden Publikationen dargestellt bzw. dort auf entsprechende Original-Literatur verwiesen [21]
Die Variationen, mit denen ich arbeite, betrafen bisher
- Aufgaben, mit denen die Fähigkeit zur Unterscheidung sprachlicher Laute geprüft wird [22]
- einzelne Untertests aus dem HAWIK [23]
- Aufgaben zur Feststellung der Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb
- sportmotorische Anforderungen
- Lernaufgaben zur Entwicklung der Fähigkeit korrekten perspektiven Zeichnens, ein von
der DFG kleingefördertes, inzwischen abgeschlossenes Projekt. [24]
Über zwei dieser Inhalte ergaben sich dann gemeinsame Forschungs-Interessen mit Angehörigen des Gießener Instituts, so dass darüber der Kontakt, wenn auch nur punktuell, bestehen blieb. Darüber habe ich mich sehr gefreut!
Zur Zeit arbeite ich an einem von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unterstützten Projekt an der Entwicklung einer Variationsfolge von Items zur Feststellung der Lernbasis und zur Indikation von Fördermaßnahmen bei einfachen zweigliedrigen Rechenaufgaben. [25]
Bei meinen früheren Arbeiten hatte ich aus den schon genannten Gründen, nämlich Prioritäten zugunsten konzeptioneller und programmatischer Arbeiten zu setzen, auf empirische Untersuchungen zur Modellprüfung verzichtet und die Empirie lediglich im Sinne klinischer Studien betrieben. Inzwischen arbeite ich wieder statistisch und experimentell, indem ich überprüfe, ob die theoretisch postulierten Abfolgen der einzelnen Variationen eine Leistungshierarchie bzw. psychometrische Hierarchie bilden, welche den individuellen Lernstand eindeutig abbilden, und ob zusätzlich noch die Berücksichtigung des individuellen Lernstandes positive Auswirkungen auf künftiges Lern- und Leistungsverhalten hat, das heißt ob die theoretisch postulierten und psychometrisch abgesicherten Leistungshierarchien auch als Lern- oder Transfer-Hierarchien – etwa im Sinne von Resnick – valide sind. Dies ist sicher auch eine Fragestellung des Projekts AUF, Angewandte Unterrichtsforschung, [26] und damit schließt sich vorläufig der Kreis meiner Verbindung zum hiesigen Institut.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde,
ich hoffe, es ist spürbar geworden, dass ich mit dieser Tour d’horizon meinen akademischen Lehrern aus der Gießener Zeit ein kleines Zeichen des Dankes geben wollte dafür, dass sie mir das Interesse für sinnvolle und bisweilen faszinierende psychologische Fragestellungen, aber auch das zu deren Beantwortung notwendige methodische Handwerkszeug vermittelt haben.
[1] Heiss, R. (1964). Handbuch der Psychologie, 6. Band: Psychologische Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.
[2] Janke, W. (1964). Experimentelle Untersuchungen zur Abhängigkeit der Wirkung psychotroper Substanzen
von Persönlichkeitsmerkmalen. Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft.
[3] Janke, W. (1964). Klassifikation. In R. Heiß (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, 6. Band. Psychologische Diagnostik (S. 901-929). Göttingen: Hogrefe.
[4] Cronbach, L.J. & Gleser, G. (1957). Psychological Tests and Personnel Decisions. Urbana: University of Illinois Press. (2. Aufl. 1965).
[5] Wewetzer, K.-H. (1964). Intelligenztests für Kinder. In: R. Heiss (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische Diagnostik (S. 200-225). Göttingen: Hogrefe.
[6] Kornmann, R. (1971). Hirnschädigung und fehlende Schulreife. Berlin: Marhold
[7] Kornmann, R. (1977). Testbatterie für entwicklungsrückständige Schulanfänger (TES). Weinheim:Beltz.
[8] Mandl, H. & Krapp, A. (1972). Zum Problem der Punktwertgrenzen bei der Interpretation von Schulreife-
testergebnissen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 4, 140-146.
[9] Kornmann, R. (1972). Minimalisieren Schulreifetests die Zahl der Fehlentscheidungen? Kommentar zum Bericht von Mandl & Krapp: Zum Problem der Punktwertgrenzen bei der Interpretation von Schulreifetestergebnissen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 4, 282-286.
[10] Tiedemann, J. (1974). Die Problematik der Schuleingangsdiagnose unter entscheidungstheoretischem Aspekt. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 6, 124-132.
[11] Probst, H. (1973). Die scheinbare und wirkliche Funktion des Intelligenztests im Sonderschulüberweisungsverfahren. In I. Abé, H. Probst, S. Graf, R. Kutzer, G. Wacker, W. Klode & H. Wagner: Kritik der Sonderpädagogik (S. 107-183). Lollar: Achenbach.
[12] Langfeldt, H.-P. (1975). Alternativmodell zur praktizierten Umschulungsdiagnostik. In R. Kornmann (Hrsg.), Diagnostik bei Lernbehinderten (S. 58-73). Rheinstetten: Schindele
[13] Kornmann, R. (1982). Von der Auslesediagnostik zur Förderdiagnostik: Entwicklungen, Konzepte, Probleme. Behindertenpädagogik, 21, 293-309
[14] Wewetzer, K.-H. (1962). Die Arbeitsweise der diagnostischen Psychologie. Studium Generale, 15, 112-120.
[15] Kornmann, R., Endrigkeit, F. & Sander, H. (1972). Sind lernbehinderte Sonderschüler in Gruppen-Intelligenztests benachteiligt? Zwei vergleichend – empirische Untersuchungen. diagnostica, 18, 111-121.
[16] Gottschaldt, K. (1933). Der Aufbau des Kindlichen Handelns. Leipzig: Barth.
[17] Jantzen, W. (1987). Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Weinheim: Beltz.
[18] Hacker, W. (1973). Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Berlin: Verlag der Wissenschaft.
[19] Volpert, W. (1974). Handlungsstrukturanalyse als Beitrag zur Qualifikationsforschung. Köln: Pahl-Rugenstein
[20] Greif, S. (1983) Konzepte der Organisationspsychologie. Bern: Huber.
[21] Kornmann, R. (1981). Psychometric tests and the need to assess abilities in planing educational programmes für the mentally retarded. In B. Cooper (Hrsg.), Assessing the Handicaps and Needs of Mentally Retarded Children. London: Academic Press, 107-116; ins Norwegische übersetzte Fassung in Studiedokument nr. 23, Spesialpedagogisk studieretning, Lillehammer: Oppland district hogskole, 1982.
[22] Kornmann, R. & Rößler, G. (1983). Variation der Untersuchungsbedingungen als förderungsdiagnostisches Prinzip am Beispiel eines Verfahrens zur Prüfung der Fähigkeit der Lautunterscheidung. In R. Kornmann, H. Meister & J. Schlee (Hrsg.), Förderungsdiagnostik (S. 102-106). Heidelberg: Schindele
[23] Kornmann, R. & Zickwolf, A. (1985). Möglichkeiten qualitativer Leistungsdiagnostik durch Variation der Testbedingungen am Beispiel von HAWIK-Items. In D. Albert (Hrsg.), Bericht vom 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie vom 23.-27.9.1984 in Wien (S. 61-66). Göttingen: Hogrefe
[24] Kornmann, R. & Ullrich-Kehder, R. (im Druck). Entwicklung und Validierung einer Lernhierarchie zum Fähigkeitserwerb korrekten perspektivischen Zeichnens. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie.
[25] Kornmann, R. & Schäffler, G. (im Druck). Förderdiagnostik bei einfachen Kopfrechenaufgaben: Ermittlung der Lernbasis durch systematische Item-Variationen. Heilpädagogische Forschung.
[26] Schott, F. (1988). AUF! Für verstärkte angewandte Unterrichtsforschung! Aktuelle Ansätze und Forschungsaufgaben zur Optimierung lehrzielorientierter Lehr-Lern-Prozesse – Versuch einer systematischen Übersicht. Arbeitsgruppe „Kognition und Instruktion“ des Fachbereichs 06 Psychologie der Justus Liebig-Universität Gießen. Diskussionspapier Nr. 25.